Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, bilden eine Stofffamilie von schätzungsweise zehntausend synthetischen Verbindungen, deren chemischer Kern – eine extrem feste Kohlenstoff-Fluor-Bindung – sie beinahe unvergänglich macht. In der Fachwelt nennt man sie deshalb „Ewigkeitschemikalien“. Was PFAS so gefährlich macht, ist jedoch nicht allein ihre nahezu unbegrenzte Haltbarkeit, sondern die Kombination aus Persistenz, Mobilität und Toxizität: Sie zerfallen in der Umwelt praktisch nicht, breiten sich über Luft, Wasser und Böden weiträumig aus und reichern sich schließlich in Lebewesen an, wo sie das Immun- und Hormonsystem stören, den Cholesterinspiegel erhöhen und das Risiko bestimmter Krebsarten, allen voran Nieren- und Hodenkrebs, ansteigen lassen. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA hat diese Gefahren 2020 in eine der niedrigsten jemals festgelegten Aufnahmemengen übersetzt: Mehr als 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche sollten Menschen dauerhaft nicht aufnehmen (Quelle: EFSA). Ein dreißigstel Millionstel Gramm – kleiner lässt sich ein Grenzwert kaum noch denken.
Wie PFAS in unsere Umwelt gelangen
Ursprünglich galten PFAS als Wunderchemikalien. Sie machen Outdoor-Jacken wasser- und schmutzabweisend, sorgen dafür, dass Pommes-Schachteln nicht durchweichen, verhindern als Tensid das Überschäumen in Feuerlöschschäumen und halten elektronische Leiterbahnen in der Halbleiterfabrikation frei von Korrosionsrückständen. Gerade weil sie Hitze, Säuren und Basen mühelos widerstehen, sind sie in Tausenden Produkten im Einsatz – von der Zahnseide bis zur Solarmodul-Beschichtung. Doch derselbe Widerstand, der sie in der Produktion so wertvoll macht, wird zum ökologischen Albtraum, sobald PFAS während des Herstellungsprozesses, beim Waschen einer Jacke oder über entsorgte Beschichtungen in die Umwelt gelangen. In Abwässern passieren sie die meisten Kläranlagen unbeschadet, in Böden wandern sie mit dem Grundwasser langsam weiter und selbst in der Atmosphäre lassen sie sich als ultrafeine Partikel noch hunderte Kilometer vom Ursprungsort nachweisen.
Gesundheitliche Folgen
Im menschlichen Körper binden sich PFAS überwiegend an Eiweiße im Blutplasma; die Halbwertszeit der berüchtigten Perfluoroktansäure (PFOA) wird bei Erwachsenen auf über zwei Jahre geschätzt, bei einigen neueren PFAS-Varianten noch höher (Quelle: Umweltbundesamt Deutschland). Studien aus den USA und Skandinavien zeigen, dass erhöhte Blutspiegel mit einer geringeren Impfantwort bei Kindern, einem höheren Risiko für Schwangerschaftshypertonie und einer veränderten Schilddrüsenfunktion zusammenhängen. Gleichzeitig ist die Exposition schleichend: Ob Trinkwasser, Fischfilet oder Popcornbeutel – jede kleine Belastung addiert sich zu dem, was bereits im Körper zirkuliert. Wer einmal hohe Werte aufweist, kann sie kaum aktiv abbauen; sie sinken nur nach und nach, wenn keine weiteren PFAS hinzukommen, was in unserer Konsumwelt kaum realistisch ist.
Hotspots in Deutschland
In Deutschland lenkte zuerst der Skandal rund um Rastatt und Baden-Baden die öffentliche Aufmerksamkeit auf PFAS. Dort wurden Anfang der 2000er-Jahre papierhaltige Klärschlämme als Düngematerial auf Äcker ausgebracht. Laborprüfungen kamen deutlich zu spät; erst 2013 wurde erkannt, dass das Material mit hohen PFAS-Gehalten belastet war. Seitdem gelten rund 1 200 Hektar als kontaminiert, das Grundwasser transportiert eine Schadstofffahne Richtung Rhein. Eine Sanierung in Form tiefer Bodenabträge wird noch Jahrzehnte und voraussichtlich dreistellige Millionenbeträge beanspruchen (Quelle: Regierungspräsidium Karlsruhe).
In Altötting in Oberbayern ist die Situation anders, aber nicht weniger heikel. Hier war es kein Schlamm, sondern der Ausstoß eines Chemieparks, in dem PFOA jahrzehntelang als Zusatzstoff in Teflon-Beschichtungen diente. Abgas und Abwasser verteilten die Substanz kilometerweit, sodass selbst private Brunnen noch heute über dem deutschen Leitwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter liegen (Quelle: Landratsamt Altötting). Das Trinkwasser aus öffentlichen Netzen wird inzwischen mit Aktivkohle gereinigt, doch die Kosten tragen die Verbraucher über ihre Wassergebühren.
Auch Nordrhein-Westfalen weist gravierende Belastungsherde auf. Im Chempark Leverkusen, einem der größten Chemiestandorte Europas, ergaben Messungen zeitweise PFAS-Konzentrationen im Abwasser, die den Orientierungswert um das Zehnfache überstiegen. Die Folge waren Einleitungen direkt in den Rhein; Umweltschützer wie der BUND sprechen von einer andauernden Gefährdung für Flora und Fauna im Mündungsgebiet (Quelle: BUND).
Daten der Europäischen Umweltagentur zeigen zudem, dass in fast sechzig Prozent der deutschen Flüsse und fast der Hälfte der Küstengewässer wenigstens ein PFAS zwischen 2018 und 2022 oberhalb der ökologischen Qualitätsnorm lag (Quelle: Europäische Umweltagentur). Das bedeutet nicht zwingend, dass überall Höchstwerte im Trinkwasser erreicht werden, aber es verdeutlicht, wie flächig die Grundbelastung bereits ist.
Österreich: Flughäfen als Brennpunkte
In Österreich tauchen die höchsten Konzentrationen dort auf, wo regelmäßig Löschschaum zur Brandbekämpfung oder für Übungen eingesetzt wurde. Ein besonders anschauliches Beispiel liefert der Salzburger Flughafen. Jahrzehntelang versickerte Schaummittel mit PFOS- und PFHxS-Zusätzen auf einem Übungsgelände. Heute zieht sich eine mehrere Kilometer lange Schadstofffahne durch das Grundwasser; eine Großfilteranlage läuft seit 2024, doch die Betreiber rechnen mit Jahrzehnten Entsorgungsaufwand (Quelle: Land Salzburg).
Das österreichische Umweltbundesamt hat 2023 an 316 Messstellen das Trinkwasser geprüft. Zwar überschritten nur 0,74 Prozent der Proben den künftigen Verbots- und Aktionswert von 0,1 Mikrogramm pro Liter für die Summe ausgewählter PFAS, doch das genügt, um regionale Versorgungsträger in Zugzwang zu bringen. Parallel untersuchte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Fisch, Fleisch und Milchprodukte. In Fischen aus Flüssen im Zentralraum wurden PFOS-Spitzenwerte bis 2,6 Mikrogramm pro Kilogramm gemessen; auch in Kalbs- und Putenfleisch fanden sich signifikante Gehalte (Quelle: AGES). Für Kinder, Schwangere und Vielesser kann das bedeuten, dass die tolerierbare Wochenaufnahme schneller ausgeschöpft wird als im europäischen Mittel.
Schweiz: Noch lückenhafte Daten, aber wachsende Sorge
Die Schweiz führt eine flächendeckende PFAS-Datenerfassung erst seit wenigen Jahren systematisch durch. Eine erste Bestandsaufnahme des Bundesamts für Umwelt (BAFU) wies 2022 in 94 Prozent aller Bodenproben messbare PFAS-Summengehalte unter fünf Mikrogramm pro Kilogramm aus. Völlig unbelastete Proben gab es jedoch keine. Auffällig sind Standorte im dicht besiedelten Mittelland und im Kanton Zürich, wo Industriebetriebe, Flughäfen und Müllverbrennungsanlagen nahe beieinander liegen. Zwar liegen die meisten Wasserversorger aktuell unter den eidgenössischen Höchstwerten von 0,3 Mikrogramm pro Liter für PFOS und PFHxS beziehungsweise 0,5 Mikrogramm pro Liter für PFOA, aber Experten beim Wasserforschungsinstitut Eawag warnen, dass schon wenige neue Einleitstellen ausreichen, um diese Puffer schrumpfen zu lassen (Quelle: Eawag).
Ein Sonderfall ist das Wallis. Dort sorgte eine Chemiefabrik bereits Ende der 1980er-Jahre für spezifische Einträge, die bis heute nachwirken. Behörden analysieren derzeit, ob belastete Oberböden in landwirtschaftlichen Betrieben abgetragen oder langfristig wie Deponien versiegelt werden müssen (Quelle: Kanton Wallis).
PFAS in Lebensmitteln
Dass PFAS nicht nur ins Wasser, sondern längst in die Nahrungskette gelangt sind, zeigte 2025 eine europaweite Untersuchung der NGO Pesticide Action Network Europe. Sie analysierte Proben von Wein und stellte fest, dass die Konzentration der Zerfallsverbindung Trifluoressigsäure, kurz TFA, seit dem Jahrgang 1988 stetig gestiegen war und in einzelnen Flaschen hundertfach über den üblichen Trinkwasserkonzentrationen liegt (Quelle: PAN Europe). Zwar schneiden Bio-Weine etwas besser ab, doch sie sind keineswegs frei von Rückständen.
Deutschland, Österreich und die Schweiz haben deshalb seit 2022 ihre Lebensmittelüberwachung ausgeweitet. Besonders kritisch sind Produkte aus Flüssen und Seen in der Nähe bekannter Hotspots, da Fische PFAS in Leber und Muskelgewebe anreichern. Auch Innereien von Landtieren weisen häufig höhere Werte auf, weil sich PFAS an Proteine binden. Eine Kennzeichnungspflicht gibt es bislang nicht, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher PFAS-Arme Produkte kaum erkennen können.
Trinkwasseraufbereitung und Technische Lösungen
Um die Schadstoffe aus dem Wasser zu entfernen, setzen Versorger in allen drei Ländern vermehrt Aktivkohlefilter oder Ionenaustauscherharze ein. Aktivkohle bindet vor allem langkettige PFAS wirksam, muss jedoch regelmäßig regeneriert oder entsorgt werden. Ionenaustauscher haben ein breiteres Wirkspektrum, sind aber teuer in Anschaffung und Betrieb. Manche Kommunen prüfen ergänzend Membranverfahren wie Nanofiltration oder Umkehrosmose, die nahezu alle PFAS-Varianten entfernen, aber hohe Energiekosten verursachen. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung schätzt, dass die Einführung großflächiger PFAS-Filter in Deutschland Mehrkosten von bis zu 14 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser bedeuten könnte (Quelle: UFZ).
Politische Initiativen und Regulatorik
Politisch ist das Thema längst auf höchster Ebene angekommen. Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen reichten 2023 bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA den bislang umfassendsten Beschränkungsantrag der EU-Chemikaliengesetzgebung ein. Ziel ist ein nahezu vollständiges Verbot aller nicht-essentiellen PFAS-Anwendungen. Ausnahmen sollen nur dort gelten, wo es keine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Alternative gibt, etwa in bestimmten Medizinprodukten oder bei hochspezialisierten Halbleiterprozessen (Quelle: ECHA). Die Industrie fordert für solche Bereiche Übergangsfristen von bis zu zwölf Jahren, während Umweltverbände ein weit engeres Zeitfenster anmahnen.
Parallel hat die EU mit der neuen Trinkwasserrichtlinie einen strengen Summengrenzwert für zwanzig weit verbreitete PFAS eingeführt, der bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Deutschland plant, zusätzlich einen Orientierungswert für die Gesamt-PFAS-Belastung festzulegen, damit Forschung und Vorsorge schneller reagieren können (Quelle: Bundesgesundheitsministerium).
In der Schweiz ist ein generelles Verbot noch nicht in Reichweite, doch das Parlament verschärfte 2024 die Altlastenverordnung, sodass Kantone kontaminierte Böden leichter als Sanierungsfall deklarieren können. Österreich koppelt seine Strategie vor allem an Aktionspläne für die Hotspots rund um Flughäfen und an eine nationale Plattform für schadstofffreies Trinkwasser (Quelle: Umweltbundesamt Österreich).
Was Verbraucher tun können
Bis sich gesetzliche Verbote und technische Lösungen durchsetzen, bleibt die Eigenvorsorge wichtig. Konsumentinnen und Konsumenten können bereits beim Einkauf auf PFAS-freie Alternativen achten. Outdoor-Textilien tragen zunehmend Kennzeichnungen wie „PFC-free“ oder „eCorepel“; Pfannen aus Edelstahl oder Gusseisen kommen ohne fluorierte Beschichtungen aus. Ski-Wax mit Fluorzusatz sollte man, wenn überhaupt, in gut belüfteten Räumen verarbeiten und Reste nicht im Abfluss entsorgen. Wer in einem bekannten Hotspot wohnt, kann mit zertifizierten Tischfiltern auf Aktivkohlebasis den PFAS-Gehalt im Leitungswasser reduzieren; allerdings filtern einfache Pitcher-Filter nicht zuverlässig alle Verbindungen. Nur Umkehrosmoseanlagen beseitigen das gesamte Spektrum, erfordern aber regelmäßige Wartung und verursachen Abwasser.
Kostenschätzungen und Ausblick
Die Europäische Umweltagentur rechnet in ihrem jüngsten Bericht mit jährlichen Ausgaben von bis zu 84 Milliarden Euro, die durch Gesundheitsschäden, Wassersanierung und Produktionsverluste auf Europa zukommen könnten, wenn PFAS unbegrenzt weiter in Umlauf blieben (Quelle: Europäische Umweltagentur). Darin noch nicht eingerechnet ist der Verlust an Ökosystemleistungen, der etwa durch geschädigte Fischbestände oder Bodenfruchtbarkeit entsteht.
Selbst wenn die EU das geplante PFAS-Verbot verabschiedet, bleiben die historischen Einträge bestehen. Chemikerinnen und Chemiker verweisen auf leicht verzögert wandernde Boden- und Grundwasserfahnen, die über Jahre hinweg neue Landstriche erreichen. Damit gleicht die Altlast einer Zeitbombe, die zwar langsam tickt, deren Zerstörungskraft aber nicht geringer ist. Rastatt, Altötting, Salzburg und Zürich illustrieren, wie komplex die Sanierung wird, wenn PFAS erst einmal großflächig verteilt sind.
Die Herausforderung liegt also nicht nur in der Technik, sondern auch im politischen Willen und im Konsumverhalten. Jede neue Jacke ohne Fluorimprägnierung, jedes Unternehmen, das auf PFAS-freie Prozesse umstellt, und jede Gemeinde, die ihr Löschwasser auf alternative Schaummittel umstellt, schneidet der Altlast ein Stück weit die Nachschubwege ab. Ein endgültiger Befreiungsschlag ist das nicht – aber es ist der einzige Weg, die Risiken für kommende Generationen wenigstens einzudämmen.
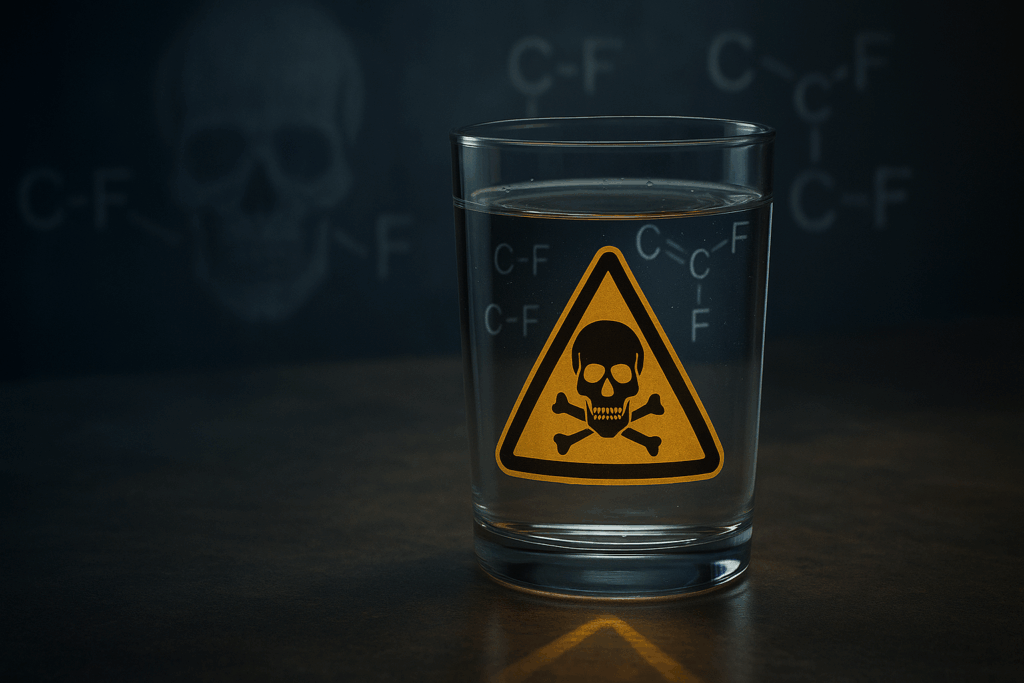
Weitere Beiträge
„Legionellen-Alarm: Warum Warmwasser zur tödlichen Gefahr werden kann – und welche Lösungen wirklich helfen“
Thermische Desinfektion: Die teure Legionellen-Lüge im Warmwasser
Bluthochdruck-Skandal? Angebliche Grenzwert-Manipulation?