Legionellen – unsichtbare Gefahr im Wassernetz
Legionellen gehören seit Jahren zu jenen unsichtbaren Risiken, die die Betreiber öffentlicher wie privater Wassersysteme gleichermaßen beunruhigen. Krankenhäuser, Pflegeheime, Thermen und kommunale Einrichtungen stehen dabei besonders im Fokus, doch auch Mehrfamilienhäuser oder Einfamilienobjekte sind nicht frei von Gefahr. Die Debatte um Prävention und Bekämpfung dieser Bakterien ist lebendig, häufig kontrovers und geprägt von technischen wie regulatorischen Zwängen. Im Zentrum steht stets die Frage, welche Maßnahmen wirksam, wirtschaftlich und dauerhaft sind. Bereits in der jüngsten Diskussion um die sogenannte thermische Desinfektion, die in vielen Fachkreisen als teuer und oft unzureichend kritisiert wird, zeigt sich ein Muster: Was einst als unantastbarer Standard galt, erweist sich zunehmend als angreifbar.
Biologie und Gefahrenpotenzial
Legionellen sind stäbchenförmige, im Wasser lebende Bakterien, die sich bei Temperaturen zwischen dreißig und fünfundvierzig Grad Celsius besonders wohlfühlen. Unterhalb von zwanzig Grad vermehren sie sich nur langsam, ab sechzig Grad verlieren sie ihre Überlebensfähigkeit, während ab siebzig Grad eine sichere Abtötung angenommen werden kann. Diese Werte sind seit Langem in den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation und in den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts verankert. Für gesunde Menschen stellen Legionellen im Trinkwasser beim bloßen Konsum keine Gefahr dar. Kritisch wird es, wenn bakterienhaltige Aerosole eingeatmet werden. Dies geschieht beim Duschen ebenso wie beim Betrieb von Klimaanlagen oder bei feinen Wasservernebelungen im Alltag. Gelangen die Erreger tief in die Lunge, können sie die sogenannte Legionärskrankheit auslösen, eine schwere Form der Lungenentzündung, die für Menschen mit geschwächtem Immunsystem tödlich verlaufen kann.
Totleitungen und Stillstand als Brutstätten
Die Herausforderung im Umgang mit Legionellen liegt weniger in der Theorie ihrer Bekämpfung, sondern in der Praxis der Gebäudeversorgung. Rohrnetze sind komplex, sie wachsen über Jahrzehnte, sie tragen Spuren vergangener Umbauten und stillgelegter Bereiche. Dort, wo Leitungen nicht mehr genutzt, aber nicht konsequent entfernt wurden, entstehen die berüchtigten Totleitungen. In ihnen stagniert Wasser über Wochen, Monate, mitunter Jahre. Sie bieten Legionellen ideale Brutbedingungen. Betreiber, die einst ein Gästezimmer in einen Lagerraum verwandelten und die angeschlossenen Sanitäreinrichtungen stilllegten, ohne die Leitungen von der Zentrale zu trennen, schufen damit ungewollt ein Reservoir. Solche vergessenen Stränge sind in älteren Gebäuden keine Seltenheit. Oft fehlen aktuelle Pläne, Rohre verlaufen hinter Wänden, verschwinden in Schächten, werden zugemauert. Der technische Dienst vieler Einrichtungen steht vor der paradoxen Aufgabe, gegen eine Gefahr vorzugehen, deren Quelle nicht immer eindeutig zu lokalisieren ist.
Die Pandemie hat dieses Problem verschärft. Wo Thermen, Schwimmbäder oder Sporthallen monatelang geschlossen blieben, fehlte die regelmäßige Entnahme, die unter Normalbetrieb das Netz durchspült hätte. Betreiber sahen sich gezwungen, Pseudobetriebe zu organisieren. Mitarbeiter gingen in regelmäßigen Abständen durch Duschräume, öffneten Hähne, ließen Wasser laufen, nur um das System künstlich am Leben zu erhalten. Dieser Aufwand, der im Frühjahr 2020 vielerorts improvisiert eingeführt wurde, verdeutlichte den strukturellen Schwachpunkt: Leitungsnetze sind auf permanente Zirkulation angewiesen, Stillstand ist ihr größter Feind.
Kritik an der thermischen Desinfektion
Die klassische Antwort auf Legionellengefahr lautete lange Zeit thermische Desinfektion. Nach den einschlägigen technischen Regeln wurde gefordert, dass Trinkwasserleitungen auf mindestens sechzig Grad Celsius erwärmt werden. In akuten Fällen sollten Temperaturen von siebzig Grad oder mehr gefahren werden, um bestehende Nester zu eliminieren. Doch der Aufwand dafür ist immens. In großflächigen Netzen, etwa in Krankenhäusern, bedeutet es enorme Energiemengen, das gesamte System durchgängig auf diesem Niveau zu halten. Zugleich sind die Folgen für die Anlagen selbst erheblich. Dichtungen, Armaturen, Rohrverbindungen leiden unter den hohen Temperaturen. Die Verbrühungsgefahr für Nutzer steigt, zusätzliche Mischarmaturen werden nötig. Nicht zuletzt wächst der energetische Fußabdruck einer Methode, die in Zeiten wachsender Energieknappheit und steigender Kosten kaum noch vertretbar wirkt. Fachleute sprechen inzwischen von einem überkommenen Konzept, das zwar in den technischen Regelwerken fortlebt, in der Praxis aber zunehmend hinterfragt wird. Fachartikel, die in jüngster Zeit in Branchenmedien erschienen, bezeichnen die thermische Desinfektion bereits als „teure Legionellen-Lüge“.
Chemische Verfahren und ihre Grenzen
Chemische Verfahren schienen lange eine Alternative. Chlor oder Chlordioxid, Silberionen oder andere Biozide wurden in Leitungen eingebracht, um die Bakterienlast zu reduzieren. Doch diese Methoden haben ihre eigenen Schattenseiten. Sie greifen in das Trinkwasser selbst ein, hinterlassen Rückstände, verändern Geschmack und Qualität. In Einrichtungen mit vulnerablen Personen, etwa Krankenhäusern oder Pflegeheimen, ist die Akzeptanz solcher Eingriffe gering. Hinzu kommt, dass Legionellen in Biofilmen Schutzmechanismen entwickeln, die sie gegen chemische Angriffe resistenter machen. Ein vollständiges Ausrotten wird so selten erreicht, vielmehr beginnt ein Kreislauf von wiederholter Dosierung und periodischen Sanierungen.
Neue physikalische Ansätze
Angesichts dieser Schwächen suchen Wissenschaft und Industrie nach physikalischen Alternativen. In den vergangenen Jahren haben sich Verfahren etabliert, die mit Strömungskräften, Druckdifferenzen und Kavitation arbeiten. Dabei wird Wasser unter hohem Druck in spezielle Reaktionsbehälter geführt, in denen extreme Strömungs- und Scherkräfte entstehen. Diese Kräfte zerreißen die Zellhüllen der gramnegativen Bakterien. Das Verfahren benötigt weder hohe Temperaturen noch chemische Zusätze. Es fügt sich in bestehende Netze ein, oft im Bypass, und kann mit überschaubarem Installationsaufwand betrieben werden. Hersteller verweisen darauf, dass die Technologie in mehreren Pilotprojekten erfolgreich eingesetzt wurde. Unabhängige Studien dazu sind bislang noch begrenzt, doch das Prinzip entspricht bekannten physikalischen Grundlagen. Hierin liegt eine Chance, die Diskussion um Legionellenprävention neu auszurichten, weg von der chemischen Keule, hin zu nachhaltigen, ressourcenschonenden Lösungen.
Ein neuer Blick auf die Praxis
Vergleicht man den aktuellen Stand mit den Debatten der letzten Jahrzehnte, so fällt auf, wie sehr sich die Wahrnehmung verschoben hat. Vor zwanzig Jahren war die thermische Desinfektion unantastbar. Heute sprechen Fachleute offen von ihren Grenzen. Der Vorwurf lautet, dass sich ein ganzer Sektor zu lange auf eine Methode verlassen habe, die nie so sicher war, wie sie schien. Dass Betreiber Jahr für Jahr hohe Energiekosten aufwenden mussten, ohne dauerhaft Ruhe zu haben, wirkt im Rückblick wie eine Fehlsteuerung. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die alltäglichen Herausforderungen, dass einfache Antworten nicht existieren. Totleitungen in verwinkelten Bestandsgebäuden, Leerstände, improvisierte Stilllegungen – sie alle erzeugen Bedingungen, die Legionellen in die Karten spielen. Hier zeigt sich, dass Prävention mehr ist als Technik. Sie verlangt Organisation, Pflege, Bewusstsein. Betreiber müssen ihre Netze kennen, dokumentieren, regelmäßig prüfen. Jede stillgelegte Dusche, jeder vergessene Abzweig kann zum Problem werden.
Fazit: Die Suche nach einem zukunftsfähigen Weg
Der Leitartikel darf deshalb nicht mit der Illusion enden, dass eine einzelne Technologie das Problem endgültig lösen werde. Vielmehr deutet die Erfahrung darauf hin, dass ein Bündel von Maßnahmen nötig bleibt: die sorgfältige Planung neuer Gebäude mit klaren Leitungsstrukturen, die konsequente Stilllegung ungenutzter Stränge, die Nutzung physikalischer Methoden zur bakteriellen Kontrolle und die Bereitschaft, Regelwerke regelmäßig dem Stand der Wissenschaft anzupassen. Legionellen werden nicht verschwinden. Sie sind Teil unserer Umwelt, im Grundwasser ebenso wie in natürlichen Gewässern. Doch wir können lernen, mit ihnen so umzugehen, dass sie kein Risiko für Gesundheit und Leben darstellen.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich die aktuelle Debatte. Zwischen energiefressender Desinfektion, chemischer Belastung und innovativen, noch jungen Verfahren liegt die Suche nach einem Weg, der praktikabel, sicher und zukunftsfähig ist. Es bleibt Aufgabe von Wissenschaft, Industrie und Regulierung, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Denn Legionellen sind nicht das Problem einzelner Häuser oder Branchen, sie sind ein gesamtgesellschaftliches Thema, das unsere Infrastruktur im Kern betrifft. Wer es ernst meint mit der Sicherheit des Trinkwassers, muss bereit sein, überkommene Konzepte zu hinterfragen und neue Ansätze zu erproben. Nur dann wird es gelingen, das Vertrauen in eines unserer wichtigsten Güter zu bewahren.
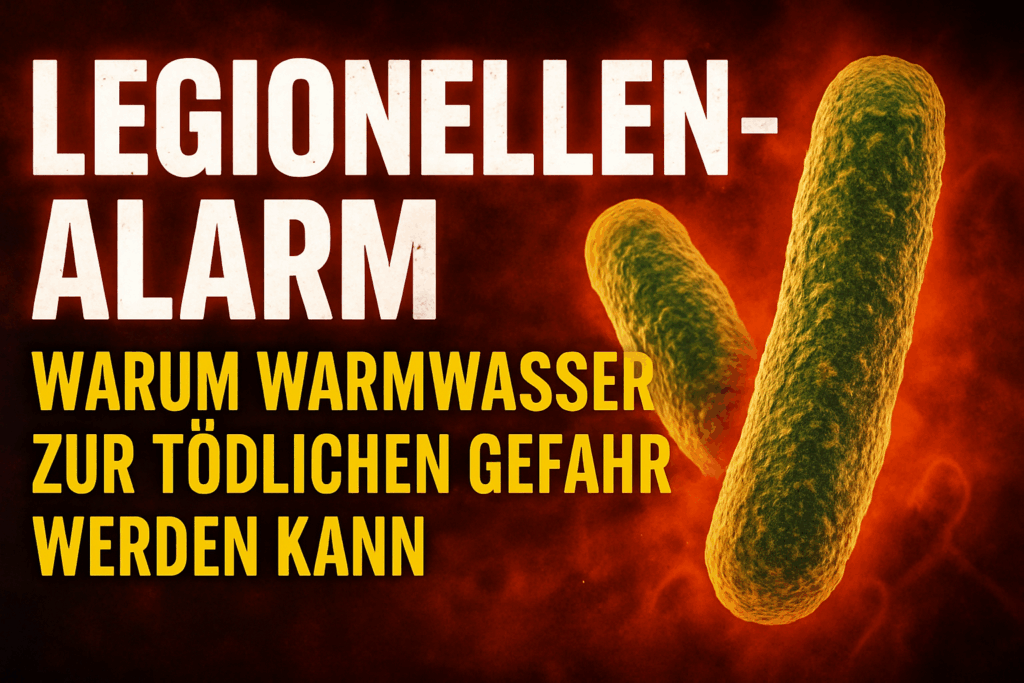
Weitere Beiträge
“Geheime Technikmacht: Wie ein Verein Deutschlands Regeln schreibt – und Brüssel warnt”
Selenski entmachtet Korruptionsbehörde – Zerbricht jetzt Europas Vertrauen in die Ukraine?
Taurus ohne Trägersystem? Warum die Ukraine mit dem deutschen Marschflugkörper nichts anfangen kann