Wie marode Leitungen, Bakterien & Hitze unser Schweizer Trinkwasser bedrohen!
Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Fast überall genügt ein Griff zum Hahn, schon sprudelt kühles, meist kostenloses Trinkwasser, das in internationalen Vergleichen zur Weltspitze gehört. Wer jedoch etwas tiefer blickt, entdeckt Risse im glänzenden Image. Rohre aus den Wirtschaftswunderjahren nähern sich gleichzeitig ihrem Lebensende, Sommerhitze treibt die Temperaturen in Hausinstallationen in gefährliche Bereiche, und Legionellen finden ideale Bedingungen. Zugleich müssen Wasserwerke ihr Seewasser «aufhärten», damit es Leitungen nicht zerfrisst. Eine Reise durch das unterirdische Rückgrat unseres Alltags zeigt, wo Gefahren lauern und wie Fachleute dagegen vorgehen.
Ein Netz kommt in die Jahre
Rund 53 000 Kilometer Trinkwasserleitungen durchziehen die Schweiz, also etwa eine Erdumrundung. Expertinnen und Experten des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches, kurz SVGW, verweisen darauf, dass viele Leitungen eine erwartete Lebensdauer von fünf bis acht Jahrzehnten besitzen. Damit der Bestand intakt bleibt, müssten jährlich ungefähr zwei Prozent des Netzes erneuert werden. Praktisch geschieht das zwar, doch genügt es nur, wenn die Quote dauerhaft durchgehalten wird. Gerade kleinere Gemeinden verschieben kostspielige Bauvorhaben jedoch gern, bis ein Rohrbruch die Hauptstrasse flutet und die Feuerwehr anrücken muss.
Eine ganze Generation von Leitungen wurde in den Sechziger- und Siebzigerjahren verlegt. Ihr Zustand verschlechtert sich nun gleichzeitig und landesweit. Korrosion, Materialermüdung und Erdverschiebungen lassen die Zahl der Zwischenfälle langsam, aber stetig zunehmen. Schätzungen des SVGW zufolge gehen jährlich rund 120 Milliarden Liter Trinkwasser verloren, weil es durch Risse und Löcher ins Erdreich sickert. Das entspricht knapp drei Prozent des gesamten schweizerischen Verbrauchs und kostet die Versorger hunderte Millionen Franken, allein weil aufbereitetes Wasser nutzlos in den Boden verschwindet.
Im Durchschnitt ist eine Schweizer Transportleitung heute gut vierzig Jahre alt. Während Städte wie St. Gallen in Stichproben einen Wasserverlust von lediglich acht Prozent erzielen, verlieren Netze in ländlichen Regionen bis zu fünfzehn Prozent. Landesweit pendelt die Quote bei rund dreizehn Prozent – immer noch weniger als in vielen europäischen Nachbarländern, aber deutlich mehr als in digital streng überwachten Musternetzen der Stadt Zürich. Fachleute beziffern den Investitionsbedarf der nächsten zwanzig Jahre auf einen hohen einstelligen Milliardenbetrag. Die Mittel fließen zwar grösstenteils über die Wassergebühren direkt in die Netze zurück, dennoch schieben Gemeinden ohne finanzielle Polster Sanierungen in die Zukunft.
Wenn kaltes Wasser zu warm wird
Parallel zum Alterungsproblem zeigt sich ein neues Risiko, das der Klimawandel verstärkt. In Hausinstallationen darf Kaltwasser eigentlich nie wärmer als 25 Grad Celsius werden. Diese Temperaturgrenze ist in den Richtlinien des SVGW und im Schweizer Normwerk SIA festgeschrieben, weil Legionellen in lauwarmem Wasser ideale Wachstumsbedingungen finden. Sobald die Temperatur länger über dieser Schwelle liegt, vermehrt sich der Keim binnen Stunden.
Moderne Gebäude verschärfen die Lage, weil Architektinnen aus Energiespargründen Kalt- und Warmwasserleitungen eng beieinander in gut gedämmten Schächten führen. Während Ferienabwesenheiten oder in wenig benutzten Räumen stagniert das Wasser, nimmt die Umgebungswärme an und erreicht schnell problematische Werte. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, registrierte im Jahr 2023 landesweit 576 Fälle von Legionärskrankheit, fast dreimal so viele wie noch fünfzehn Jahre zuvor. Die meisten Infektionen treten im Hochsommer auf, wenn das vermeintlich kalte Leitungswasser lauwarm aus der Armatur kommt.
Neue technische Regeln verlangen darum kürzere Leitungswege, dickere Dämmungen, intelligente Spülprogramme sowie Temperaturfühler, die Alarm schlagen, bevor sich die Risikozone einstellt. Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer müssen lernen, dass Legionellen nicht nur in Warmwasserboilern gedeihen, sondern längst auch die Kaltseite im Blick haben. Gleichzeitig zeigen Studien der Eidgenössischen Wasserforschungsanstalt Eawag, dass extreme Hitze und Starkregenereignisse das Legionellenproblem verschärfen, weil sie Oberflächenwasser erwärmen und Keime vermehrt in Quellgebiete gespült werden.
Warum Seewasser «aufgehärtet» werden muss
Rund achtzig Prozent des Schweizer Trinkwassers stammen aus Grund- und Quellfassungen. Sie liefern von Natur aus ausreichend Calcium und Magnesium. Grosse Städte wie Zürich, Lausanne oder Basel sichern ihre Versorgung jedoch zu weiten Teilen mit Wasser aus Seen oder Flüssen. Dieses Oberflächenwasser ist nach der Filtration so weich, dass es metallische Rohrleitungen angreift. Weiches Wasser löst Kupfer und andere Metalle, was nicht nur den Geschmack beeinträchtigt, sondern auch Leitungen schneller altern lässt.
Um das zu verhindern, dosieren Wasserwerke gezielt Härtebildner. Das Seewasserwerk Lengg in Zürich etwa spritzt dem filtrierten Wasser eine Suspension aus Kalkmilch zu, versetzt es mit Kohlendioxid, bis sich Calciumcarbonat bildet, und hebt so die Gesamthärte auf Werte zwischen 14 und 19 französischen Härtegraden an. Das liegt in der Spanne, die als «mittelhart» gilt und Haushaltsgeräte sowie Leitungen schont.
Die Methode erfüllt mehrere Zwecke zugleich. Sie stabilisiert den pH-Wert, bildet in metallischen Leitungen eine schützende Mineralhaut und liefert Kalzium als lebenswichtigen Spurennährstoff. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, kurz BLV, zählt die Aufhärtung zu den anerkannten Aufbereitungsverfahren. Jede Charge wird protokolliert, und unabhängige Labore prüfen regelmässig, ob Vorgaben für Mineralstoffgehalt, Mikrobiologie und Geruch eingehalten sind.
Keime im Wasser – selten, aber niemals Null
Trotz seines hervorragenden Rufes ist auch Schweizer Hahnenwasser nicht steril. Oberflächengewässer bringen natürliches Plankton, Bakterien und gelegentlich Viren mit. Quell- und Grundwasser können mit Fäkalkeimen belastet sein, wenn Gülle falsch ausgebracht wird oder Pestizide in zu hohen Dosen auf Feldern landen. Die Grundregel lautet: Je flacher oder offener ein Einzugsgebiet, desto öfter müssen Wasserwerke vorübergehend klären, filtern und desinfizieren.
Im Sommer 2024 etwa musste die Stadt Uster ihr Netz für fünf Tage mit Chlor behandeln und die Bevölkerung zum Abkochen aufrufen, nachdem Rückstellproben Escherichia-coli-Bakterien gezeigt hatten. Solche Ereignisse bleiben die Ausnahme, doch sie demonstrieren, wie rasch Verunreinigungen auftreten können, wenn Sturmregen Schachtdeckel anhebt oder ein alter Dichtungsring in einer Schieberklappe versagt. Legionellen stehen besonders im Fokus. Seit 2010 hat sich die Zahl der gemeldeten Legionellose-Fälle mehr als verdoppelt. Das BAG führt das teilweise auf längere Hitzeperioden und eine alternde Bevölkerung zurück, die empfänglicher für schwere Verläufe ist.
Die Wasserwirtschaft reagiert mit strengeren Temperaturkontrollen, häufigeren Stichproben in Hotels, Spitälern und Altersheimen und einer überarbeiteten Probenahme-Richtlinie. Thermische oder chemische Schocks in Warmwasseranlagen sind zwar wirksam, doch auf Dauer helfen nur konsequente Spülzyklen, hohe Spitzentemperaturen in Boilern und kalte Leitungswege, in denen Stagnation vermieden wird. Gleichzeitig erforscht die Eawag antibiotikaresistente Bakterienstränge im Abwasser. Dort treten sie konzentriert auf, werden aber in modernen Kläranlagen so weit zurückgehalten, dass sie das Trinkwasser kaum erreichen. Das Abwasser-Monitoring liefert trotzdem wertvolle Hinweise auf regionale Resistenztrends und hilft, Ausbrüche früh zu erkennen.
Wie Versorgungssicherheit geschaffen wird
Trotz aller Risiken bleibt die Versorgung hierzulande eine Erfolgsgeschichte, weil Technik und Know-how vorhanden sind. Viele Versorgungsunternehmen setzen inzwischen digitale Zonenwasserzähler ein. Wenn der nächtliche Mindestverbrauch in einem Sektor plötzlich ansteigt, kann die Software ein Leck auf wenige Hundert Meter eingrenzen. In Zürich, St. Gallen und Chur liegt der Wasserverlust dadurch unter acht Prozent. Gemeinden mit stark zerklüftetem Terrain und dünn besiedelten Tälern tun sich schwerer, weil jeder neue Sensor mit Strom, Funk und Wartung verbunden ist. Dennoch verbessert sich die Datenlage kontinuierlich.
Netzbetreiber knüpfen zudem ihre Leitungen zu überregionalen Ringen. Versiegt im Hochsommer eine Quellfassung, kann die Nachbargemeinde kurzfristig aushelfen. Das Seewasserwerk Langmatt im Kanton Aargau pumpt beispielsweise nicht nur die Stadt Baden, sondern über eine 32 Kilometer lange Transportleitung auch das Limmattal, falls dort ein Pumpwerk ausfällt. Redundante Strukturen kosten zwar, doch sie steigern die Resilienz gegenüber Störungen aller Art.
Gebäudetechnik spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle. Architektinnen legen heute kalte Zonen für Frischwasserleitungen an und setzen automatische Ventile ein, die stagnierendes Wasser ablassen. Temperature-Logger melden Unregelmässigkeiten, und digitale Gebäudeleitsysteme verbinden Warm- und Kaltwasserkreisläufe mit Energiemanagement. Erfahrungen aus Krankenhäusern zeigen, dass schon einfache Fließprogramme Legionellenzahlen deutlich absenken. Solche Erkenntnisse erreichen inzwischen auch den Wohnungsbestand, weil Bau- und Liegenschaftsämter sie in Ausschreibungen vorschreiben.
Die Normenlandschaft entwickelt sich weiter. Der SVGW überarbeitet seine Richtlinie W3, und die SIA-Norm 385/1 schärft Grenzwerte sowie Prüfpflichten. Erstbetreiberprüfungen für neue Gebäude verlangen künftig nicht nur Wasserqualitätsmessungen, sondern eine Gefährdungsanalyse inklusive Temperaturlogging. Eigentümer müssen sich auf Sanierungsfristen festlegen, sobald Grenzwerte überschritten werden. Fachleute begrüssen die Neuerungen, weil sie Intransparenz abbauen und Prävention in den Vordergrund stellen.
Auf Behördenseite denkt das Bundesamt für Gesundheit über ein Frühwarnsystem nach, das Labormeldungen mit Daten aus Temperatursensoren in Netzen koppeln könnte. Vorbild ist das landesweite Abwasser-Monitoring, das während der Corona-Pandemie erfolgreich etablierte. Es lieferte der Öffentlichkeit frühere Hinweise auf steigende Fallzahlen, als klinische Tests es vermochten. Ein ähnliches Dashboard für legionellenverdächtige Gebäudedaten könnte Handlungsspielräume für Spitalhygiene und Tourismusbranche erweitern.
Ein Blick in die Zukunft
Der Klimawandel stellt die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen. Höhere Luft- und Bodentemperaturen verkürzen die Regenerationszeiten der Quellhorizonte, extreme Niederschläge spülen Sedimente in Fassungen, und längere Trockenperioden lassen Oberflächengewässer stärker erwärmen. Gleichzeitig verlagern sich Siedlungs- und Arbeitsräume, wodurch bislang entlegene Netze ausgebaut werden müssen. Dies alles erhöht den Investitionsdruck.
Fachleute der Eawag empfehlen eine Kombination aus baulichen, organisatorischen und digitalen Massnahmen. Künstliche Intelligenz kann Lecks schneller lokalisieren, wenn sie tausende Messpunkte gleichzeitig auswertet. Geringfügige Druckänderungen an Hydranten oder ein verändertes Strömungsverhalten im Rohrnetz genügen, um Alarm auszulösen. Erst Versorger mit hoher Datentiefe, wie jene der Stadt Zürich, zeigen, welches Potenzial darin steckt: Verluste sinken, und Rohrbrüche lassen sich oft Stunden vor dem eigentlichen Ereignis vorhersehen.
Viele Gemeinden statten zudem zentrale Wasserbehälter mit Photovoltaik aus, um Pumpen zumindest teilweise mit Solarstrom zu betreiben. Dadurch sinken Betriebskosten, und Stromausfälle lassen sich leichter überbrücken. Das Bundesamt für Umwelt unterstützt derartige Projekte, solange sie den Landschaftsschutz berücksichtigen.
Die wohl sichtbarste Veränderung erreicht jedoch die Privatkundschaft. Wer sich ein neues Bad einbauen lässt, erhält heute oft elektronische Armaturen, die bei jedem Öffnen eine kleine Kaltwasserspülung abfahren. Hersteller programmieren Spülpausen exakt auf das Nutzungsprofil, damit weder unnötig Wasser verschwendet wird noch Legionellen eine Chance erhalten. Zugleich ermöglichen Mikrochips im Ventil, Verbrühschutz und Energieeinsparung zu kombinieren.
Fazit
Das Trinkwasser in der Schweiz bleibt ein Luxus direkt aus der Wand. Doch das komfortable Selbstverständnis, dass dieser Luxus ewig sprudeln werde, erhält Risse. Alternde Leitungen verlieren Wasser, Extremwetter heizt Kaltwasser auf, und Mikroben nutzen jede Chance. Gleichzeitig erfordert weiches Seewasser gezielte Aufhärtung, damit es nicht selbst zum Korrosivum wird. Die gute Nachricht lautet: Die notwendigen Technologien, das Fachwissen und das Geld sind vorhanden. Werterhalt des Netzes, konsequentes Temperaturmanagement in Gebäuden und eine offene Kommunikation zwischen Behörden, Versorgern und Öffentlichkeit sind machbar – und sie zahlen sich aus. Wasser ist das sensibelste Lebensmittel überhaupt. Es verdient mehr Aufmerksamkeit, als wir ihm bisher schenken. Nur wenn wir es pflegen, bleibt der Griff zum Hahn auch künftig ein unbeschwerter Genuss.
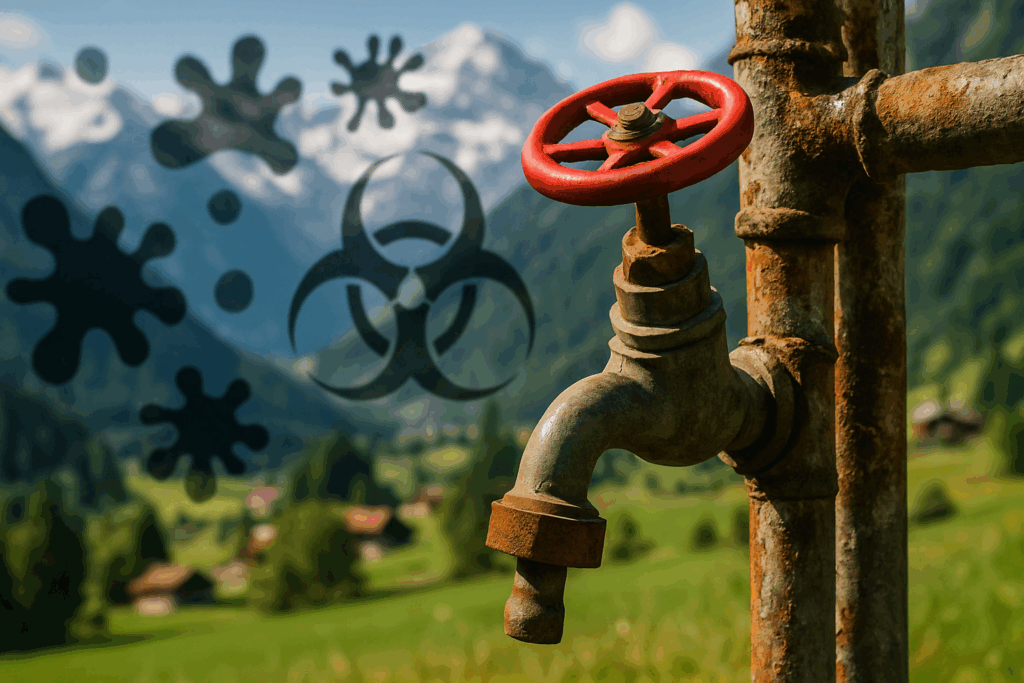
Weitere Beiträge
„Legionellen-Alarm: Warum Warmwasser zur tödlichen Gefahr werden kann – und welche Lösungen wirklich helfen“
Thermische Desinfektion: Die teure Legionellen-Lüge im Warmwasser
Bluthochdruck-Skandal? Angebliche Grenzwert-Manipulation?