Kaum eine Branche bestimmt die wirtschafts- und industriepolitische Agenda im deutschsprachigen Raum so nachhaltig wie die Chemie. Spätestens seit dem Energiepreisschock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 hat sich der Einfluss der großen Konzerne weiter verdichtet. Im vergangenen Jahr gaben Lobbyorganisationen hierzulande laut Bundestagsregister und Tagesschau-Analyse auf Bundesebene rund eine Milliarde Euro für Interessenvertretung aus; der Verband der Chemischen Industrie (VCI) und einzelne Unternehmen rangieren dabei unter den finanzstärksten Akteuren, deren Mandatierte im politischen Berlin ein und aus gehen.
Dass finanzieller Druck und politischer Gestaltungswille ineinandergreifen, zeigt sich exemplarisch am Marktführer BASF. Während der Ludwigshafener Konzern 2024 trotz schwächelnder Nachfrage noch 65,3 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 7,9 Milliarden Euro auswies, erwirtschaftete er in Europa weniger als die Hälfte seines Ergebnisses und verlegte Investitionsschwerpunkte nach China und in die Golfregion. Parallel dazu wuchs das politische Netz. Im Lobbyregister des Bundestags sind derzeit 18 fest akkreditierte BASF-Vertreter gelistet; sie pflegen den Kontakt zu Ministerien und Abgeordneten, sitzen in Fachbeiräten und begleiten Gesetzesinitiativen von der Chemikalienpolitik bis zur Energieversorgung.
Mit dem Regierungswechsel in Berlin im Mai 2025 veränderte sich der Ton, nicht aber die personelle Nähe. Friedrich Merz, dessen Karriere einst als Referent des VCI begann, residiert nun im Kanzleramt. Recherchen von Correctiv und Abgeordnetenwatch offenbaren, wie eng der CDU-Chef bis heute mit Führungskräften von BASF, Covestro und Bayer vernetzt ist; etliche Beraterinnen und Berater aus dem Industriekosmos nahmen unmittelbar nach der Vereidigung strategische Rollen in den neuen Regierungsstäben ein.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ließ sich im vergangenen Winter gar als „Schutzpatron der Chemie“ titulieren, nachdem die Staatsregierung zusätzliche Strompreis-Entlastungen für Großabnehmer in Aussicht gestellt hatte. Zugleich öffnete der Bund einen milliardenschweren Transformationsfonds, dessen Vergabekriterien von Industrievertretern im Nationalen Wasserstoffrat entscheidend mitformuliert wurden. In diesem Gremium sitzen neben Energie-Start-ups auffallend viele Manager der etablierten Chemieriesen; BASF stellte im März 2025 Deutschlands bisher größte PEM-Elektrolyse in Ludwigshafen vor und sicherte sich dafür 134 Millionen Euro an Beihilfen aus Brüssel.
Der Einfluss endet nicht an der Landesgrenze. In Brüssel tobt seit zwei Jahren der Kampf um ein weitreichendes Verbot der PFAS-Substanzen. Eine internationale Recherchekooperation – das „Forever Lobbying Project“ – dokumentiert, wie Lobbyisten der Fluor-Chemie systematisch wissenschaftliche Studien relativierten, Abgeordnete mit Positionspapieren überhäuften und Fristen in EU-Ausschüssen so lange verzögerten, bis der Entwurf im Frühjahr 2025 deutlich abgeschwächt wurde. Le Monde belegte, dass dabei auch Kommunikationsabteilungen von DAX-Unternehmen beteiligt waren, deren Werke in Nordrhein-Westfalen und Hessen stehen.
Während Deutschland die Schlagzeilen dominiert, zieht die Chemie ihre Drähte auch in Wien. Die 300 heimischen Betriebe erlitten 2023 einen Produktionseinbruch von über zehn Prozent, doch bereits Anfang 2024 deutete sich eine Bodenbildung an, die der Fachverband der chemischen Industrie (FCIO) politisch flankierte. Gespräche über ein „Brückenstrompreis-Modell“ begleiteten die traditionell harten Kollektivvertragsverhandlungen, in denen Arbeitgeberseite und Gewerkschaft PRO-GE letztlich Lohnerhöhungen von 2,65 Prozent ab Mai 2025 vereinbarten. Parallel meldete Borealis ein Rekordjahr bei Patentanmeldungen und steigerte, laut interner Zahlen, das bereinigte EBITDA auf über eine Milliarde Euro; mehr als zwanzig Mitarbeiter der OMV-Tochter sind in Brüssel offiziell registriert, um an der Ausgestaltung der Kunststoff-Verpackungsverordnung mitzuwirken.
In der Schweiz schließlich trifft wirtschaftliche Dominanz auf politische Raffinesse. Chemie-Pharma-Exportgüter machten 2024 erneut 52 Prozent der Gesamtausfuhren aus; der Wert von 149 Milliarden Franken markierte einen Rekord und trug maßgeblich zu einem Handelsbilanzüberschuss von 13,6 Milliarden Franken im ersten Quartal 2025 bei. Hinter dem Erfolg steht der Branchenverband Scienceindustries, der in seinem Positionspapier zur Außenwirtschaftsstrategie unmissverständlich fordert, das stockende Rahmenabkommen mit der EU „im Sinne der Hochtechnologie“ neu zu beleben.
Die wirtschaftlichen Kennzahlen veranschaulichen, wie viel auf dem Spiel steht. Evonik steigerte im ersten Quartal 2025 den bereinigten Gewinn auf 233 Millionen Euro und bestätigte eine Jahres-EBITDA-Prognose von bis zu 2,3 Milliarden Euro, obwohl das Unternehmen parallel 2 000 Stellen abbaut. Wacker Chemie wies für 2024 trotz rückläufiger Umsätze immer noch 261 Millionen Euro Nettogewinn aus und begründet seine Lobbypräsenz ausdrücklich mit drohenden Kürzungen in der Photovoltaik-Forschung. In Zürich verkündete Sika einen historischen Rekord: 1,25 Milliarden Franken Gewinn bei 11,76 Milliarden Franken Umsatz, begleitet von deutlichen Worten des Vorstands gegen drohende US-Zölle.
All diese Beispiele zeigen, wie der politische Zugang auch personell abgesichert wird. Seitenwechsel-Datenbanken von LobbyControl dokumentieren dutzende frühere Ministerialbeamte, die heute als Regierungsbeauftragte in Unternehmensstiftungen oder als Public-Affairs-Leiter agieren; Wacker etwa führt in seinem Nachhaltigkeitsbericht gleich drei frühere Referatsleiter des BMWi als externe Berater an. Gleichzeitig zementiert der Verband Chemie-Arbeitgeber in Berlin seine Präsenz in Schlichtungskommissionen zu Klimaschutz und Energie, wodurch die Branche faktisch mit am Verhandlungstisch sitzt, wenn über Grenzausgleichsmechanismen oder Wasserstoffpipelines verhandelt wird.
Doch der aggressive Interessenvertreterstil von 2024 weicht 2025 einem strategischen Narrativ, das Nachhaltigkeit als Argument für Technologieführerschaft nutzt. Vorstände sprechen inzwischen lieber von „Zero-Carbon-Lösungen“, wenn sie im Bundestag Gehör suchen, und betonen die Notwendigkeit industriepolitischer Beihilfen, um in Europa zu bleiben. Dass der Gewinn dabei nicht leidet, belegen die Geschäftsberichte. Ebenso wenig leidet der Einfluss: Noch ehe der neue Koalitionsvertrag im Bundestag verabschiedet war, sicherte sich BASF einen Sitz im Innovation Council des Kanzleramts, Evonik entsandte eine Managerin in den Digitalrat, und ein ehemaliger Leiter der EU-Generaldirektion Umwelt wechselte zum Chemieverband Cefic, der ab Januar 2025 die Präsidentschaft des Weltchemieregelwerks ICCA übernimmt.
Das Zusammenspiel aus Gewinnstärke, Arbeitsplatzargument und geölten Netzwerken verschafft der Chemieindustrie im D-A-CH-Raum eine politische Schlagkraft, die sich trotz ökologischer Debatten kaum mindern lässt. Wer 2024 noch glaubte, steigende Energiepreise könnten das Ende der europäischen Großchemie einläuten, muss 2025 feststellen, dass sie ihre Agenda – grün eingefärbt und mit Wasserstoff versiegelt – fester verankert hat als je zuvor. Die Frage ist nicht mehr, ob die Branche Politik gestaltet, sondern ob Parlamente und Zivilgesellschaft stark genug bleiben, Grenzen zu ziehen, wenn Profitstreben und Gemeinwohl in Konflikt geraten. Die kommenden Haushalts- und Klimagesetze werden zeigen, ob aus der Liaison zwischen Wirtschaft und Staat eine zukunftsfähige Symbiose oder eine riskante Abhängigkeit erwächst.
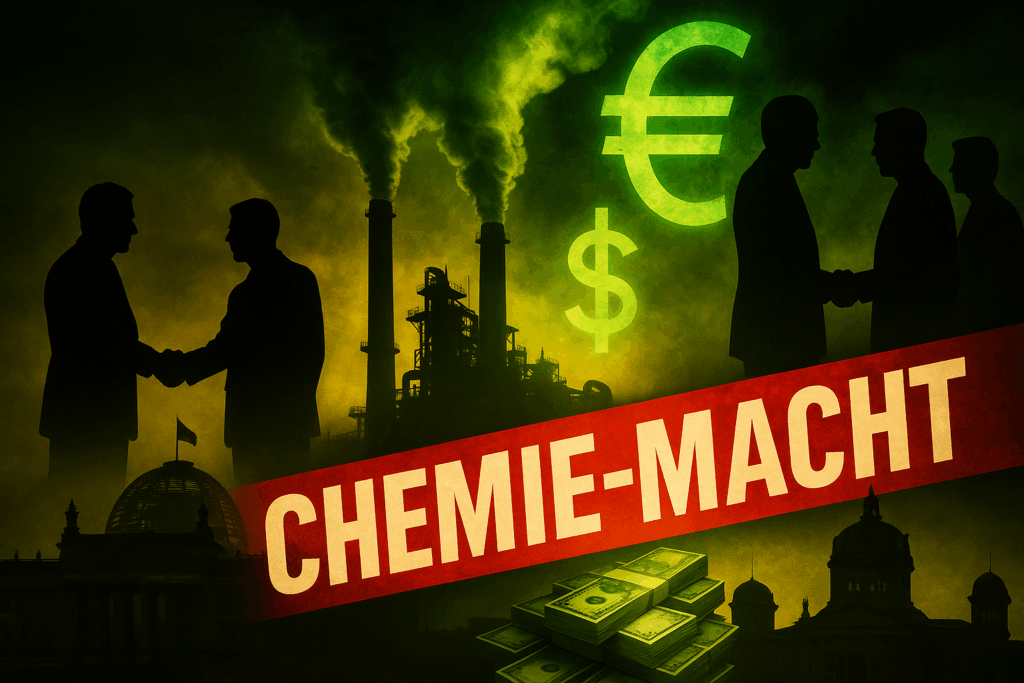
Weitere Beiträge
“Geheime Technikmacht: Wie ein Verein Deutschlands Regeln schreibt – und Brüssel warnt”
Selenski entmachtet Korruptionsbehörde – Zerbricht jetzt Europas Vertrauen in die Ukraine?
Trinkwasser-Deal: DVGW-Korruption enthüllt – Chemie-Lobby kassiert!