Als BMW Anfang März bei der IAA Mobility in München den Akku für seine nächste Fahrzeuggeneration vorstellte, klangen die Kennzahlen fast zu gut, um wahr zu sein. Dreißig Prozent mehr Reichweite, ein Drittel kürzere Ladezeiten, zwanzig Prozent höherer Energiegehalt pro Volumen – das Versprechen wirkte wie ein Befreiungsschlag in einem Markt, der bislang nur schrittweise Fortschritte kannte. Doch die Münchner präsentierten nicht bloß eine kühne Marketingidee, sondern das Ergebnis jahrelanger Grundlagenforschung.
Wer das Cell Manufacturing Competence Center im oberbayerischen Parsdorf besucht, spürt diese Arbeit in jeder Ecke. Hier betreibt BMW eine Pilotlinie, auf der komplette Batteriezellen produziert werden können. Die Ingenieurinnen und Ingenieure entschieden sich für eine Rundzelle mit 46 Millimetern Durchmesser in zwei Längen – 95 und 120 Millimeter –, weil diese Bauform den vorhandenen Bauraum optimal nutzt und den Akkupack gleichzeitig als tragendes Element im Fahrzeugboden einsetzen lässt. Das spart Gewicht und senkt den Schwerpunkt.
„Gen6 eDrive“ nennt das Unternehmen seine sechste Batteriegeneration. Sie markiert den Wechsel von prismatischen Zellen zur sogenannten 46xx-Rundzelle und führt gleichzeitig eine 800-Volt-Architektur ein. Laut Entwicklungschef Frank Weber verkürzt diese Technik nicht nur die Ladedauer um rund ein Drittel, sondern verbessert auch das Thermomanagement. Gleichzeitig sinkt die CO₂-Bilanz der Zellfertigung um bis zu 60 Prozent, da ausschließlich erneuerbare Energien eingesetzt werden.
Ein wesentlicher Punkt sind die Kosten. BMW erwartet eine Reduktion von bis zu 50 Prozent gegenüber der aktuellen Zellgeneration. Erreicht wird das durch einen geringeren Einsatz von Nickel und Kobalt sowie einen höheren Siliziumanteil in der Anode. Parallel entsteht ein LFP-Ableger für Einstiegsmodelle, der ganz ohne kritische Rohstoffe wie Nickel auskommt. So will sich der Konzern gegen Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten absichern.
In der Praxis könnte ein künftiges Mittelklassemodell – die interne Gerüchteküche spricht von einer Neuauflage des i3 – mit einer Ladung über 800 Kilometer nach WLTP zurücklegen. Auf Autobahnfahrten sollen fünfzehn bis zwanzig Minuten ausreichen, um genug Energie für weitere zweihundert Kilometer aufzunehmen. Das entspricht dem klassischen „Kaffee-und-Toiletten-Stopp“, den viele Autofahrende bereits gewohnt sind.
Damit diese Versprechen Realität werden, investiert BMW zweistellige Milliardenbeträge in neue Zellfabriken in Ungarn, Mexiko, den USA und Deutschland. Ziel sind mindestens 240 Gigawattstunden Jahreskapazität. Parallel entstehen neue Montagelinien in Dingolfing und San Luis Potosí. Beschäftigte, die einst Verbrennungsmotoren montierten, durchlaufen nun Schulungen in Hochvolttechnik, Chemikaliensicherheit und Softwarediagnose – ein sozialer Wandel, der den technologischen begleitet.
Während die sechste Generation serienreif wird, forscht BMW bereits an der siebten: der All-Solid-State-Battery (ASSB). Gemeinsam mit dem US-Partner Solid Power entstand ein Prototyp mit über 400 Wh/kg Energiedichte. Bis zur Serienreife bleiben jedoch Kostenfragen offen, und Experten erwarten den Marktstart frühestens 2030. Dennoch kündigte der Konzern für 2025 eine Demonstrationsflotte an, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Schon die Gen6-Zelle könnte hingegen den Massenmarkt neu ordnen. Studien des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung zeigen, dass Elektroautos bei Zellkosten unter 100 Euro pro Kilowattstunde preislich mit Verbrennern konkurrieren können. BMW kalkuliert intern sogar mit niedrigeren Werten. Branchenbeobachter halten daher Grundpreise unter 40 000 Euro für realistisch, ohne dass das Premium-Image leidet.
Für Kundinnen und Kunden in der Schweiz, Österreich und Deutschland spielt die Herkunft der Akkus eine Rolle. BMW betont deshalb, dass die ersten Rundzellen aus dem ungarischen Werk Debrecen stammen, wo ausschließlich Strom aus regionalen Solar- und Windparks fließt. In Österreich ist außerdem Magna-Tochter S-Volt als zweiter Lieferant im Gespräch. So entsteht eine Lieferkette, die weitgehend unabhängig von chinesischen Zwischenstufen ist – ein geopolitischer Vorteil in unsicheren Zeiten.
Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht: Alle bisher veröffentlichten Werte stammen aus Labor- und Demonstrationsbetrieb. Erst die Vorserienfahrzeuge, die Ende 2025 auf die Straße kommen sollen, werden zeigen, wie stark Temperatur, Ladeinfrastruktur oder Fahrprofil die Performance beeinflussen. Testflotten in Skandinavien und Südeuropa sind geplant, um extreme Kälte und Hitze zu simulieren. Die Ergebnisse will BMW nach dem neuen ISO-Standard 23321 offenlegen.
Sollten die Ziele erreicht werden, könnte BMW im Oberklasse-Segment den Takt vorgeben. Die „Neue Klasse“, 2023 als Studie präsentiert, verzichtet komplett auf Verbrennungsmotoren. Nun erhält diese strategische Entscheidung mit der Gen6-Batterie ihre technische Basis. Branchenkreise erwarten kurz nach dem Start der Limousine auch eine SUV-Variante, die Anhängelasten von über zwei Tonnen ermöglicht – ein wichtiger Punkt für Kundschaft im Alpenraum.
Politisch spielt BMW die EU-Strategie in die Karten. Ab 2027 sinkt der Flottengrenzwert für CO₂-Emissionen auf 40 Gramm pro Kilometer, womit selbst effiziente Plug-in-Hybride kaum noch Spielraum haben. Gleichzeitig profitieren Hersteller mit europäischer Zellfertigung vom „Green Deal“, der steuerliche Vorteile und einen erleichterten Zugang zu Rohstoffen verspricht. BMW rechnet mit einem Kostenbonus von rund acht Prozent pro Fahrzeug, wenn die Zellproduktion innerhalb der EU stattfindet.
Für private Fahrten bedeutet das mehr Alltagstauglichkeit. Wer in Zürich oder Innsbruck lebt und am Wochenende an den Gardasee fährt, muss künftig möglicherweise gar nicht mehr nachladen. Auf längeren Strecken wie Wien–Berlin schrumpft die Reisezeit im Vergleich zum Diesel auf einen moderaten Unterschied von ein bis zwei Stunden – Reichweitenangst verliert weiter an Bedeutung.
Auch gewerbliche Flotten profitieren. Taxibetreiber in Wien oder Car-Sharing-Anbieter in Berlin können Fahrzeuge rascher wieder in den Einsatz schicken, wenn fünfzehn Minuten Ladezeit reichen, um mehrere Stunden Stadtbetrieb abzudecken. Das erhöht die Auslastung und senkt die Kosten.
Darüber hinaus plant BMW eine Second-Life-Nutzung der Rundzellen in stationären Speichern. In Bayern entsteht ein Verbund aus Solarparks und Batteriespeichern, der perspektivisch über 50 Megawatt Regelenergie liefern soll. Am Ende des Lebenszyklus werden Nickel, Kobalt und Mangan recycelt und in neuen Zellen verwendet – ein geschlossener Materialkreislauf, der die Umweltbilanz weiter verbessert.
Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Tesla kämpft zwar mit der Skalierung seiner ebenfalls 46 Millimeter großen 4680-Zelle, bleibt aber technologisch vorn. Volkswagen setzt auf eine Einheitszelle und arbeitet mit QuantumScape an einer Feststoffbatterie. In China drängt BYD mit günstigen LFP-Packs nach Europa. BMW muss daher nicht nur technische, sondern auch industrielle Exzellenz beweisen.
Die kommenden zwölf Monate werden entscheidend: Dann rollen die ersten Vorserien-Packs in Versuchsträgern. Für 2025 ist die Weltpremiere des Serienfahrzeugs geplant. Gelingt BMW der Zeitplan, wäre das Unternehmen einer der ersten etablierten Premiumhersteller, der eine völlig neue Zellchemie in Großserie bringt und dabei wirtschaftlich bleibt.
Fest steht: Die sechste Batteriegeneration ist mehr als eine Optimierungsschleife. Sie entscheidet, ob BMW im Zeitalter der Elektromobilität sein technisches Renommee behaupten kann. Der Weg vom legendären Reihensechszylinder zum Hochenergieträger der Zukunft war lang, doch in München sieht es so aus, als habe man die entscheidende Abzweigung längst genommen.
Quellen: BMW Group, IAA Mobility, BMW Blog, Battery Design, Fraunhofer-ISI, The Verge
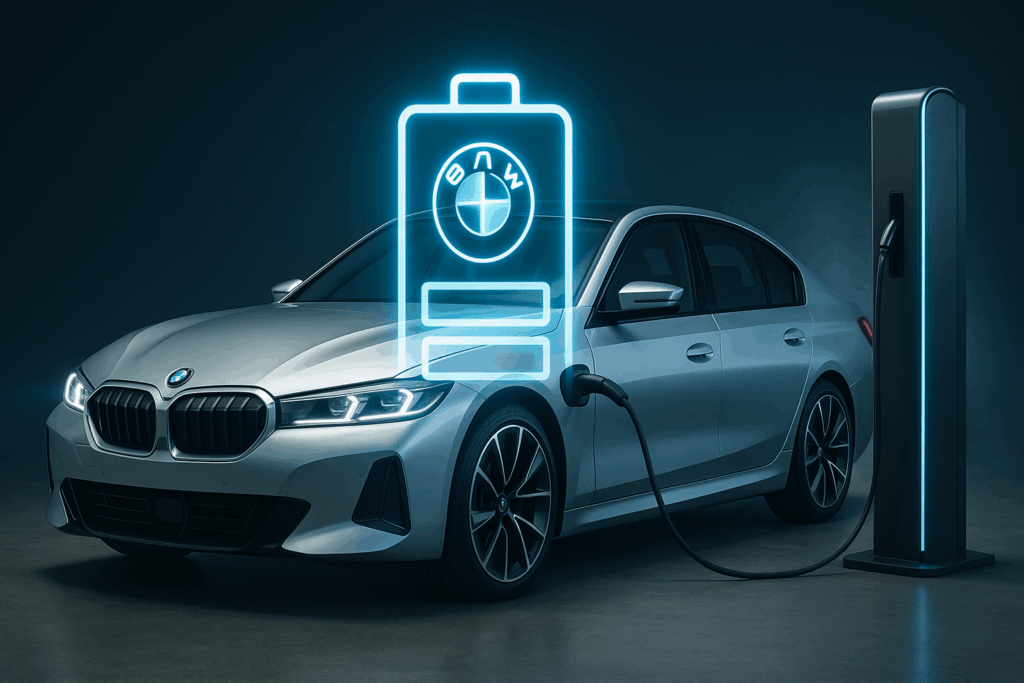
Weitere Beiträge
GPS‑SCHOCK! Ironstone Opal navigiert 50‑mal genauer – komplett ohne Satelliten
ChatGPT entfesselt
Betet ihr bald ChatGPT an?